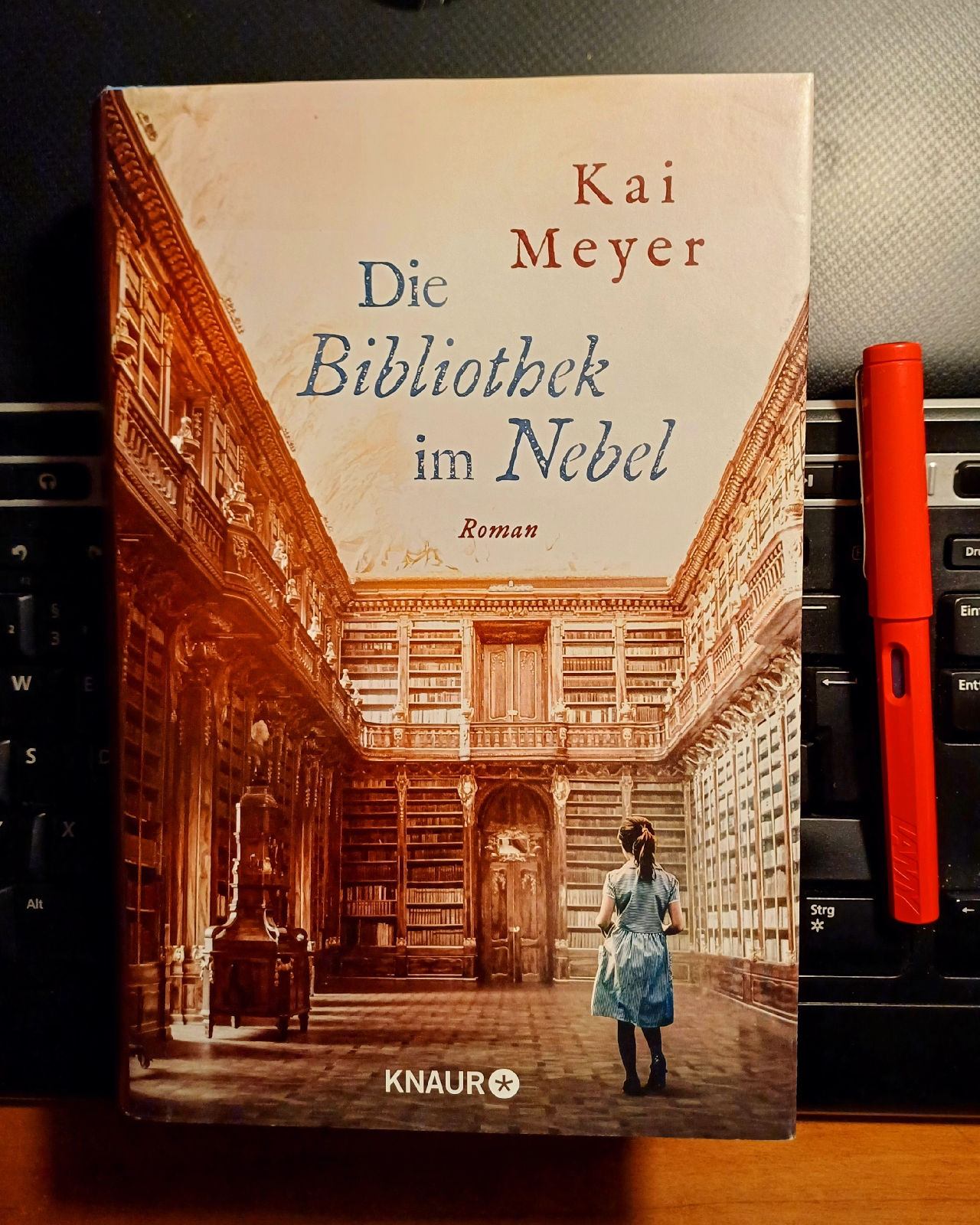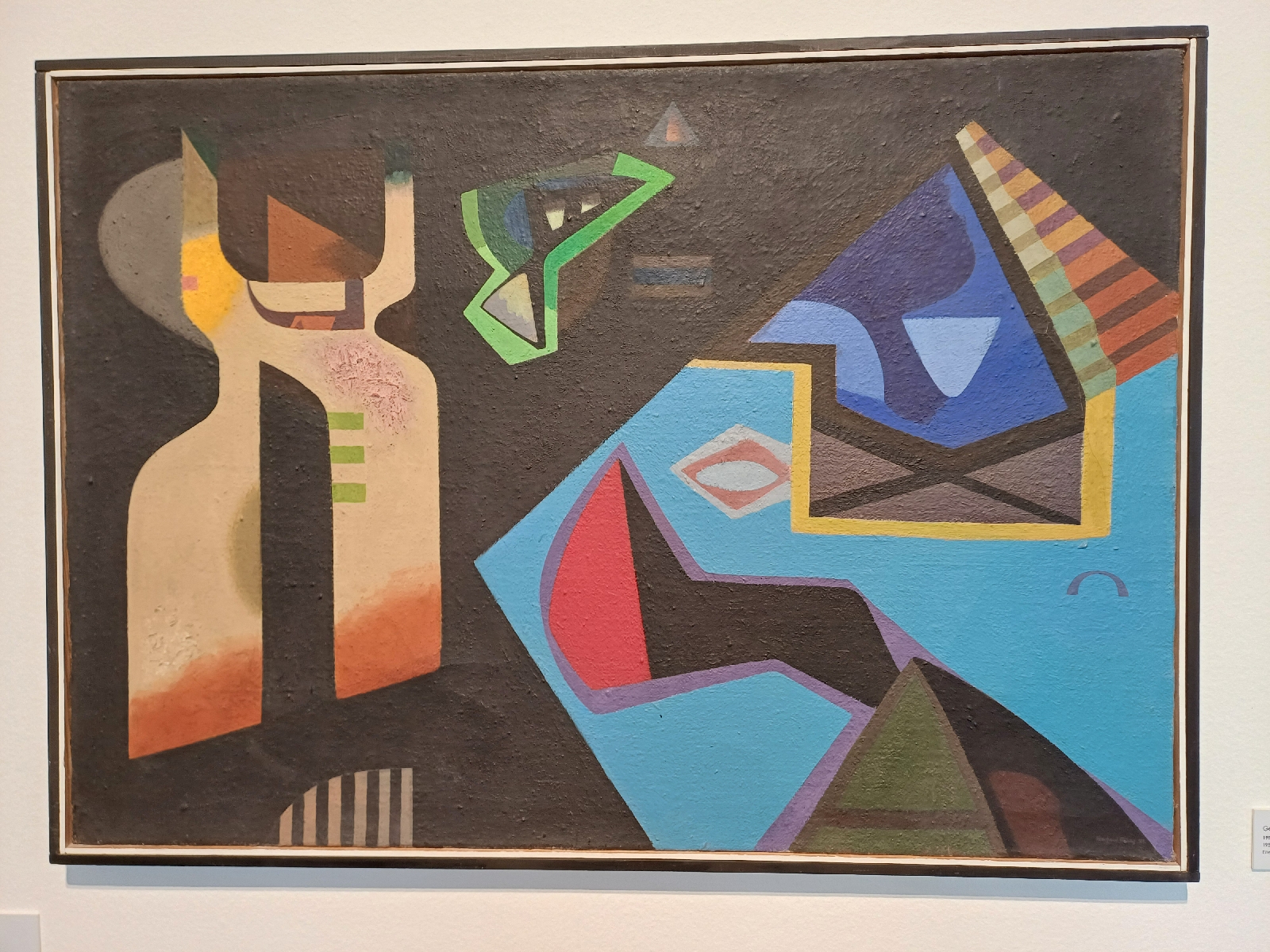Die zweistelligen Temperaturen locken Marie und mich heute zu einem langen Spaziergängen durch das Dorf. Unterwegs treffen wir viele andere Hunde und deren Menschen und andere Passanten, die sich ebenfalls über die moderaten Temperaturen freuen.
Wir laufen vorbei an den knorrigen alten Kopfweiden, die frisch geschnitten wurden, nicht einmal fünf Gehminuten entfernt vom Haus. Ich liebe die alten Schätzchen sehr und habe auch hier im Garten ein paar Stecklinge - allerdings aus Platzmangel nur in Töpfen - gepflanzt.
Früher fand das Schnittgut reißenden Absatz. Viele haben sich in ihren Gärten kleine Zäune oder Skulpturen daraus geflochten. Die waren und sind etwas Besonderes, denn Weiden treiben in der Erde neu aus und bilden gute Wurzeln. Im Nu entstehen so lebende Hecken, die einen ganz besonderen Charme haben. Doch leider entstehen auch hier, im dörflichen Raum, immer mehr "Steinbeete" oder häßliche Drahtkörbe mit Bruchsteinen sollen Grenzen bilden. Nur die "Alten" halten an ihren Blumen- und Gemüsebeeten fest. Falls kein Umdenken stattfindet, wird es auch diese Beete bald nicht mehr geben.
Auf unserem Spaziergang treffen wir regelmäßig auch "Die Drei". Eine Skulptur der Künstlerin Gisela Milse, die hier lebt und arbeitet.
In der Dorfmitte stehen noch ein paar der schönen alten Häuser. Dieses beherbergt ein Restaurant und Café und ist besonders im Sommer gut besucht.
Mich interessiert der Roman hinsichtlich der gesellschaftlichen Rolle der Frau im 18. Jahrhundert. Ich erhoffe mir Einblicke in weibliche Tugendvorstellungen, moralische Erwartungen und in soziale Zwänge dieser Zeit.
Die Protagonistin Sophie von Sternheim verkörpert das Ideal der tugendhaften Frau: Sie ist gebildet, sittsam und standhaft gegenüber unmoralischen Verlockungen. In manchen Quellen wird darauf hingewiesen, dass der Roman nicht autobiographisch ist. Trotz allem soll (und wird) er persönliche Umstände, Gedanken und Emotionen der Frau Lo Roche transportieren. Im 18. Jahrhundert wurde von Frauen erwartet, dass sie sich den gesellschaftlichen Normen anpassten und insbesondere in Liebes- und Ehefragen Zurückhaltung und Moral bewiesen. Der Roman zeigt, wie Sophies Tugend immer wieder auf die Probe gestellt wird. Ihre moralische Standhaftigkeit hebt sie jedoch von anderen Frauenfiguren ab, die sich den Erwartungen beugen oder Opfer der korrupten Gesellschaft werden.
Ein zentrales Thema des Romans ist die wirtschaftliche und soziale Abhängigkeit der Frau. Sophie von Sternheim kann als Frau nicht eigenständig handeln oder finanzielle Entscheidungen treffen. Ihr Wohl hängt (ausschließlich) von wohlwollenden männlichen Figuren oder einer günstigen Heirat ab. Diese Situation war typisch für Frauen des 18. Jahrhunderts, die oft keinerlei rechtliche oder finanzielle Selbständigkeit besaßen. La Roche zeigt die Schwächen dieses Systems auf und kritisiert die geringe Handlungsfreiheit, die Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft blieb.
Interessant ist, dass La Roche die Frau stets als höhere moralische Instanz darstellt. Während männliche Figuren sich durch Intrigen und egoistische Motive auszeichnen, steht Sophie für ein Ideal aus Selbstbeherrschung, Mitleid und Weisheit. Dieser Aspekt reflektiert ein weitverbreitetes Bild der Aufklärung: Frauen wurden als Bewahrerinnen von Moral und Tugend angesehen, während Männer diesen Zwängen natürlich nicht unterworfen wurden.
Trotzdem! hat Sophie von La Roche nach dem Tod ihres Mannes ihren Lebensunterhalt mit der Schriftstellerei erwirtschaftet.
 |
| Sophie von La Roche |
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sophie_von_La_Roche_-_Georg_Oswald_May_1778.jpg